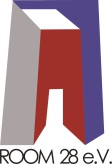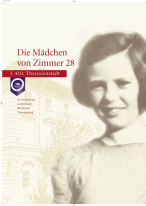Die Mädchen von Zimmer 28
Inhalt der Ausstellung
Die Ausstellungstafeln spiegeln den Alltag der "Mädchen von Zimmer 28" im Ghetto Theresienstadt, einen Alltag, gewoben aus Angst und Verzweiflung, Hoffnung und Mut. Sie erzählen von einer außergewöhnlichen Gemeinschaft und davon, was Kunst und Kultur und Erziehung zur Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit vermögen. Gleichwohl machen sie die Tragödie spürbar, in die sich die Ghettoinsassen unentrinnbar hineingeworfen sahen. Am Ende werden die meisten Mädchen aus dem Zimmer 28 und Tausende weiterer Kinder nach Auschwitz-Birkenau deportiert und in den Gaskammern ermordet.
Geleitwort von Yehuda Bauer, Jerusalem, 2004
"Es gibt hier tiefe Verzweiflung, den Verlust der Kindheit, aber auch das Wiedergewinnen der Kindheit und der Jugend durch die Freundschaft dieser Gruppe (...), die Liebe der Betreuerinnen, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft... Es ist eine sehr jüdische Geschichte und gleichzeitig eine sehr universelle. (...) Man müsste etwas daraus lernen, nicht?"
Von etwa 50 Mädchen, die vorübergehend im Zimmer 28 im Mädchenheim L 410 lebten, haben fünfzehn überlebt. Zehn der Überlebenden und zwei der einstigen Betreuerinnen nahmen aktiv an dem Erinnerungsprojekt teil. Von den Mädchen, die in Auschwitz-Birkenau ermordet wurden, sind nur wenige Fotos geblieben. Meist erinnern nur ihre Namen, Kinderzeichnungen oder Widmungen in Flaškas Poesiealbum an sie. Oder, auch dies geschah, melden sich Jahrzehnte später Menschen, die in einem der Mädchen von Zimmer 28 ihr eigens Familienmitglied entdecken - wie im Falle von Erika Stransky und Marta Kende.
Ein kurzer Abriss der Vorgänge in Deutschland und in Mitteleuropa zwischen 1933 und 1939 vermittelt zunächst den historischen Kontext und rückt jene Ereignisse im "Protektorat Böhmen und Mähren" in den Fokus, die zur Errichtung des Ghettos Theresienstadt führten und zu jenem Tag, an dem für jüdische Kinder alles anders wurde....
"So wie dieser große Pilz den kleinen Pilz schützt, so schützt dich das Heim", schrieb Eva Fischl in das Poesiealbum von Flaška, als sie sich im Oktober 1944 von ihr verabschieden musste. Das Zimmer 28 wurde zur "Insel im tobenden Meer". Erwachsene sorgten sich um die Kinder. "Unsere Betreuerinnen vermittelten uns einen Begriff von Menschlichkeit, Freundschaft und Solidarität," so Evelina Merová, geboren als Evelina (Eva) Landová. "Das gab mir Kraft. Das Mädchenheim hat mir geholfen, viel Schweres zu überstehen."
Während Tausende von Häftlingen unter desolaten Bedingungen lebten, und an Hunger, Krankheiten und seelischem Leid zugrundegingen, wollte man den Kindern ein möglichst erträgliches Leben schaffen. Und doch: Die Angst war dauernd da. Immer wieder wurden Mädchen aus ihren Reihen gerissen, sie mussten antreten zum gefürchteten Transport nach Osten...
Der "Ma'agal" (hebräisch für Kreis und im metaphorischen Sinne Vollkomenheit) veränderte die Atmosphäre in der kleinen Welt des Zimmers 28 von Grund auf. Er schien die Kraft zu haben, diffus vorhandenes Potential zu befreien, zu bündeln und ihm Form und Ziel zu gegeben. Von einem Tag zum anderen war etwas Neues da - gleichsam, als wäre über Nacht aus einer Knospe eine Blüte ausgebrochen.
Eine zentrale Rolle in der Geschichte dieser Mädchen spielt die Kinderoper Brundibár. Denn einige von ihnen spielten in der Oper mit, alle haben sie erlebt. Daher wurden die Überlebenden oft zu Brundibár-Aufführungen eingeladen. Heute erzählt die Neufassung des Buches Die Mädchen von Zimmer 28 mehr noch als die Erstausgabe aus dem Jahre 2004 von den Aufführungen der Kinderoper Brundibár in Prag und im Ghetto Theresienstadt. Siehe auch: Brundibár und die Mädchen von Zimmer 28
Weitere Tafeln sind dem Zeichenunterricht mit Friedl Dicker-Brandeis gewidmet, der besonderen Rolle der Musik in Theresienstadt und im Zimmer 28, dem Besuch des Internationalen Roten Kreuzes am 23. Juni 1944, den Dreharbeiten zum Propagandafilm und der Aufführung des Finales von Brundibár für diesen Film.
Am Ende stehen die großen Transporte im Herbst 1944, die viele der Mädchen von Zimmer 28 und mit ihnen 18.400 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportieren.
Was sie dort erleben, lässt sich beim Gang durch die Ausstellung nur erahnen...
Wer mehr darüber erfahren möchte, dem sei die Neufassung des Buches Die Mädchen von Zimmer 28 ans Herz gelegt. Es enthält weitere Kapitel zu dem, was die Mädchen erlebten, nachdem sie Theresienstadt im Oktober 1944 verlassen mussten.